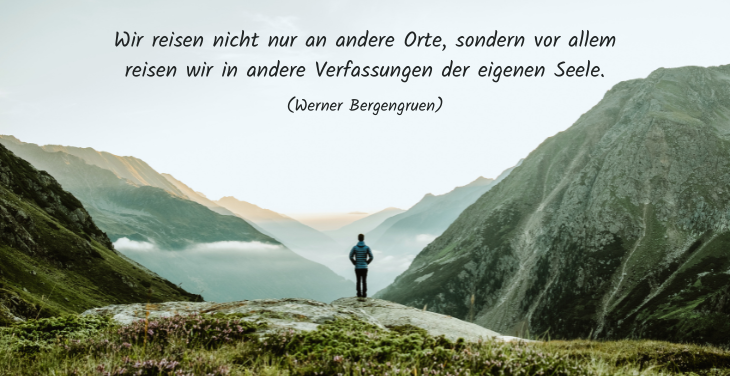Mit 19 bin ich auf eine große Reise gegangen: 4 Monate Mittelamerika – 6 Wochen davon mit zwei Freundinnen, der Rest alleine. Geplant war zuerst ein Besuch bei einem ehemaligen Gastschüler meiner 11. Klasse und seiner Familie in Guatemala Stadt. Dann 2 oder 3 Wochen Sprachschule in Quetzaltenango und danach weiterreisen nach El Salvador, wo wir im Jahr davor bereits 3 Wochen als Teil einer kleinen Jugenddelegation der evangelischen Kirche verbracht hatten. Am Ende bin ich dann tatsächlich bis nach Panama und wieder zurück nach Guatemala gereist. Denn bereits in Quetzaltenango sind wir eingetaucht in die Welt der Backpacker, von der ich bis dahin noch nicht mal wusste, dass sie existiert.
Es waren hauptsächlich junge Menschen aus den verschiedensten Ländern, die für einige Zeit (von wenigen Wochen bis zu mehreren Jahren) nomadisch lebten, ihren momentanen Besitz auf dem Rücken trugen und sich größtenteils relativ planlos von einem Ort zum anderen treiben ließen. Für mich war das eine unglaublich spannende und faszinierende Welt! Und nachdem meine Freundinnen zurück nach Deutschland gereist waren, und ich bei der Pfarrersfamilie in El Salvador geblieben war, packte mich eine starke Sehnsucht, weiterhin Teil zu sein von dieser Bewegung, die scheinbar unbegrenzt und voller toller Begegnungen und Abenteuer war. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich vollkommene Selbstbestimmung erlebt – ein Gefühl unbegrenzter Freiheit und Möglichkeiten. Und davon wollte ich noch mehr, also zog ich ungeplant alleine weiter.
Im Laufe der Zeit lernte ich dann auch die andere Seite der Freiheit kennen, wie eigenverantwortlich Entscheidungen treffen zu müssen und die Folgen davon meist unmittelbar zu erfahren. Aber genau hier begann ein tiefgehender Lernprozess: Ich lernte, auf andere Menschen zuzugehen. Ich lernte, meine Intuition wahrzunehmen und auf diese innere Stimme zu hören. Ich lernte, dass das, was auf den ersten Blick wie ein Fehler erscheint, manchmal zu den besten Erlebnissen führen kann. Und natürlich lernte ich auch ganz praktische Dinge, wie Spanisch sprechen und verstehen, die Finanzen im Blick zu behalten und die Bürokratie von Grenzübertritten zu bewältigen. Außerdem lernte ich viel über die Kulturen der Länder, die ich bereiste. Manche Einheimische fragten mich, wo denn mein Ehemann sei und ob ich Kinder hätte. Diese Fragen fand ich anfangs total absurd – ich war ja erst 19 – aber mit der Zeit verstand ich, dass mir dadurch ein Einblick in die lokale Kultur und deren Gewohnheiten geschenkt wurde. Und genau so wie mir viele Alltagsstrukturen und Bräuche vor Ort fremd waren – und wodurch das Gefühl von Neugier, Spannung und Abenteuer entstand – war ihnen meine Lebensart fremd. Mir wurde dadurch die Chance gegeben, durch eine ganz andere Perspektive auf mich und mein Leben zu schauen.
Es gab allerdings auch viele traurige Begnungen, die mich zutiefst erschüttert und ein ohnmächtiges Gefühl hervorgerufen haben: bettelnde, klebstoffschnüffelnde Staßenkinder; Familien, die in „Häusern“ aus Ästen und Plastikplanen wohnten, ohne Strom, fließend Wasser oder Herd, und die jeden Tag damit verbringen mussten, irgendetwas Essbares aufzutreiben; kranke Menschen, die keine medizinische Hilfe bekamen, weil sie nicht dafür bezahlen konnten; Arbeiter auf Kaffeeplantagen, die sehr hart arbeiteten, aber fast nichts verdienten; Indigene Kinder, die den ganzen Tag Schuhe putzen oder etwas verkaufen mussten; Teenager-Mädchen, die in Textilfabriken arbeiteten und von sexuellen Übergriffen und ihrer Machtlosigkeit berichteten. Dadurch wurde mir zunehmend deutlich, wie privilegiert ich war, wie anders die Lebensrealitäten vieler Menschen im globalen Süden aussehen, und auch wie die globalen Verstrickungen beides begünstigten. Wobei ich vieles davon auch erst im Rückblick verstand, zu sehr war ich auf dieser Reise berauscht von ständig Neuem und dem Genießen der Freiheiten, die sich mir auftaten.
Ich mochte auch das Alleine-Reisen sehr gerne. Nicht, dass ich oft wirklich alleine gewesen wäre, es waren ja fast überall auch andere Backpacker*innen unterwegs, und ich habe nach dem Überwinden von inneren Hemmschwellen und den ersten positiven Erfahrungen schnell gelernt auf andere zuzugehen, auch wenn sie älter waren als ich oder eine andere Sprache sprachen. Aber das Unterwegssein ohne Menschen, die mich schon länger kannten, hat mir ermöglicht, mich immer wieder neu auszuprobieren oder sogar neu zu erfinden. An jedem neuen Ort war ich wieder ein unbeschriebenes Blatt und konnte jedesmal aufs Neue entscheiden, wie ich mich vorstellen und zeigen möchte – welche Eigenschaften ich hervorstelle, zurücknehme oder neu ausprobiere. Dies hat mir ein Ausbrechen aus gewohnheitsmäßigen Mustern und ein spielerisches Ausprobieren neuer Versionen meiner selbst ermöglicht. Das konnte manchmal durchaus auch peinlich sein – nicht alles, was man sich als positive Eigenschaft vorstellt, passt auch wirklich zu einem – aber selbst das war nicht so schlimm, ich konnte ja jederzeit meine Sachen packen und weiterziehen.
Diese Reise fand im Jahr 2001 statt, damals gab es weder Tablets noch Smartphones und an manchen Orten noch nicht einmal einen Internetzugang – oder aber die Nutzung war so teuer, dass mein Budget nur eine kurze wöchentliche Email an meine Eltern hergab. Und das war auch gut so! Ich bekam von anderen Reisenden Empfehlungen für Unterkünfte, Sehenswürdigkeiten oder die besten Bars und Restaurants, vor Ort fragte ich mich dann weiter durch und irgendwie arrangierte sich schon alles – meist ganz anders als erwartet. Und vor allem gab es kein digitales Image, das ich pflegen musste oder wollte – es gab nur das Hier und Jetzt, und die Vergangenheit und die Heimat – „das alte Leben“ – waren weit weg.
Als ich dann nach 4 Monaten wieder zuhause ankam, hatte ich zwar nicht mein komplettes „altes Leben“, aber doch mein „altes Ich“ irgendwo zurückgelassen. Natürlich freute ich mich sehr, meine Freund*innen und auch meine Familie wiederzusehen. Und es war auch sehr schön, so manches Leibgericht, Café und Lieblingsorte wieder zu genießen. Aber meine Perspektive auf vieles hatte sich verändert. Selbst den See, an dem ich aufgewachsen war, sah ich nun mit neuen Augen. Er erschien mir auf einmal so ungewohnt schön, dass ich aus dem Staunen und Schwärmen nicht mehr herauskam – sehr zur Verwunderung und Belustigung meiner Freundinnen. Auch dass es immer fließend Wasser gab – und noch dazu warmes! – war für mich auf einmal keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern ein großes Privileg. Die Alltagssorgen der meisten Menschen in meinem Umfeld fand ich dagegen lächerlich oder sogar überheblich. Sie schienen die Welt nur durch Scheuklappen wahrnehmen zu können und waren sich dessen noch nicht einmal bewusst. Mehr als einmal wollte ich sie einfach anschreien und sagen: „Wacht auf, die Welt ist so viel größer als eure beschränkte Wahrnehmung und es gibt wirklich wichtigere Probleme!“
Zum Glück konnte ich mich mit meinen beiden Freundinnen, die am Anfang der Reise dabei gewesen waren, austauschen. Denn das erlebte ich, auch später immer wieder, als den einzigen großen Nachteil des Unterwegsseins ohne feste Begleitung: Man ist vollkommen alleine mit seinen einzigartigen Erlebnissen und Erinnerungen, und es ist unmöglich, diese anderen wirklich zu vermitteln – wer nicht dabei war, hat es nun mal nicht erlebt. Das ist logisch, aber manchmal auch sehr frustrierend. Vor allem wenn es sich um Erlebnisse handelt, die einen wirklich nachhaltig geprägt oder sogar einen Großteil des vorherigen Weltbilds auf den Kopf gestellt haben.
Mich hat es damals dann sehr schnell wieder in die Ferne gezogen und nach ein paar Monaten arbeiten und Geld sparen bin ich zuerst nach Kenia geflogen, wo ich Verwandte habe, und einige Wochen später dann nach Tansania weitergezogen. In den darauffolgenden Jahren war ich noch öfters dort, jeweils mehrere Monate am Stück. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwar schon begonnen zu studieren, aber die langen Semesterferien und der unkomplizierte Studiengang (Internationales Tourismus-Management) machten mir dies trotzdem möglich. Jede Reise veränderte mich weiter und brachte mich zunächst auch weiterhin mehr und mehr zu mir selbst.
Allerdings begann ich durch längere Aufenthalte am gleichen Ort auch zunehmend die Kehrseiten des „happy backpacker life“ wahrzunehmen – vor allem die negativen Auswirkungen, die dieses, und Tourismus allgemein, auf die lokale Kultur und Lebensumstände haben können. Ich spürte nun viel mehr nicht nur den Aspekt der Reise zu mir selbst, sondern dass wir immer und überall auch in Verbindung mit anderen stehen und dass alles, was wir tun oder lassen, einen Einfluss hat, und es sehr wichtig ist, dass wir uns darüber bewusst sind. Gleichzeitig war nach außen hin aus dem Kennenlernen, Ausprobieren und Finden meiner selbst in der Zwischenzeit eine neue Persönlichkeit entstanden, die sich für mich jetzt aber zunehmend nicht mehr authentisch anfühlte: die vielgereiste, für alles offene, stets zu Abenteuern bereite, unkomplizierte, fröhliche Anfang 20-Jährige, der die ganze Welt offen steht. Irgendwie war nun das, was als euphorisches Ausbrechen aus alten Gewohnheiten begonnen hatte, selbst zu einer neuen Maske geworden, hinter der sich mehr und mehr Schmerz über die komplizierten Verstrickungen und Ungerechtigkeiten in der Welt anhäufte. Um dies wirklich verarbeiten und integrieren zu können, und irgendwie meinen Platz in diesem ganzen Chaos zu finden, brauchte es dann erstmal wieder ein Zurückziehen aus der Welt und ein Ankommen an einem festen Ort und mit einem geliebten Menschen. Doch das ist eine andere Geschichte …
Bei der Verarbeitung mancher Erlebnisse, dem Verstehen von größeren Zusammenhängen und dem Herausbilden einer differenzierteren Haltung haben mir damals vor allem die Publikationen des iz3w – insbesondere „Fernweh: Die Jugendbroschüre zu Tourismus” und „Im Handgepäck Rassismus: Beiträge zu Tourismus und Kultur” – sowie die Webseite „Tourism Watch“ und später auch die Broschüre „Mit kolonialen Grüßen …“ des glokal e.V. geholfen. Die Broschüre kann hier bestellt oder kostenlos als PDF heruntergeladen werden.